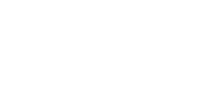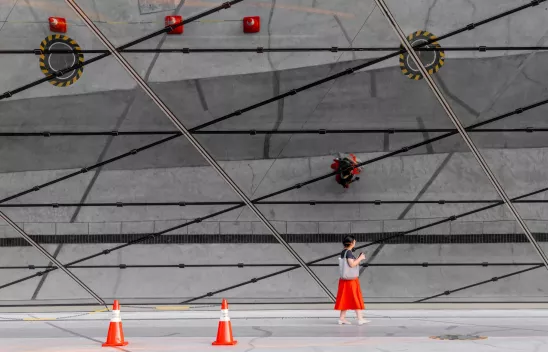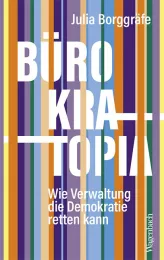Zehn Jahre Sozialplanung in NRW - Zwischen Tradition und Innovation
Im Mai 2025 veranstalteten das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der G.I.B. (Gestaltung, Innovation und Beratung in der Arbeits- und Sozialpolitik GmbH) und dem DIFIS die Veranstaltung „10 Jahre Sozialplanung in NRW“, welche aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wurde. Lisa Bartling, Ann-Kristin Reher und Wolfgang Kopal nehmen dies zum Anlass, zurückzublicken und Perspektiven der Sozialplanung aufzuzeigen.
Ein Blick zurück auf das Jahr 2015: Der Mindestlohn und die Mietpreisbremse wurden eingeführt und sollten insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen entlasten und Wohnraum bezahlbar halten. Gleichzeitig flüchteten Millionen Menschen aus Syrien und Afghanistan, um in Europa sichere Zuflucht und Asyl zu finden. In Nordrhein-Westfalen entschied sich das damalige Landesministerium für Arbeit, Integration und Soziales für die Förderung der integrierten, strategischen Sozialplanung.
Die oben genannten Entwicklungen, ebenso wie die Finanzkrise einige Jahre zuvor oder aber die Coronapandemie einige Jahre später, sind beispielhaft für Ereignisse, die Gesellschaften unvorbereitet treffen. Ein guter Daten- bzw. Informationsstand, eingespielte, koordinierte und abgestimmte Verfahren zwischen allen Akteuren im Sozialraum können hier hilfreich sein, wenn sich Verwaltungen plötzlich vor neue Herausforderungen gestellt sehen. Gleichzeitig gilt es, das in zahlreichen Kommunen etablierte (Sozial-)Berichtswesen über statistische Zustandsbeschreibungen hinaus weiterzuentwickeln, um auf gesellschafts- sowie sozialpolitische Prozesse fundiert reagieren und präventiv agieren zu können. Dies gilt umso mehr angesichts zunehmender Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten kleinräumiger Datenbestände.
Eine 2013 im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführte Erhebung (vgl. Schubert 2014) hatte zum Ergebnis, dass in einzelnen - meist größeren - Städten und Gemeinden neben der kommunalen Sozialberichterstattung integrierte Sozialplanungsprozesse bereits fester Bestandteil der politischen Steuerung waren. Akzeptanz und fachliches Verständnis waren hoch, aber von einer flächendeckenden Verbreitung konnte nicht die Rede sein. Dies war Anlass, Kreisen, Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen neben der Initiierung von Sozialplanungsprozessen über diverse Förderprogramme auch eine dauerhafte, kostenfreie Beratungsstruktur mit fachlicher Expertise zur Seite zu stellen.
Gerade weil es sich bei der Sozialplanung nicht um eine kommunale Pflichtaufgabe handelt, die Kommunalverwaltungen mit Kostensenkungen und Fachkräftemangel konfrontiert sind, gleichzeitig aber Servicegedanken und Daseinsvorsorge bewerkstelligen wollen und müssen, hielt und hält das heute zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die Bereitstellung einer unabhängigen Beratungseinrichtung mit hoher fachlicher Expertise für nachhaltig und unverzichtbar. Die Information und Schulung kommunaler Sozialplanerinnen und Sozialplaner, der Austausch und die Vernetzung über Fachbereichs- und Kommunalgrenzen hinweg bis hin zur engen Begleitung von Kommunen bei der Implementierung von Sozialplanungsprozessen sind Garanten dafür, dass die kommunale integrierte Sozialplanung landesweit an Bedeutung gewinnt.
Gute alte Tradition
Eine integrierte, strategische Sozialplanung ist also für viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen inzwischen kein Novum mehr. Insbesondere kreisfreie Städte aus dem Ruhrgebiet und Rheinland blicken inzwischen auf zehn Jahre und mehr zurück, in denen Sozialplanerinnen und Sozialplaner dazu beitragen, Lebenslagen im Stadtgebiet zu verbessern und gleichwertige Teilhabechancen herzustellen (vgl. Krupop 2024). Dass die Historie vor allem in den Ballungsgebieten liegt, hat sicherlich damit zu tun, dass diese Regionen seit mehreren Jahrzehnten mit Strukturwandel, dem Zusammenhang von sozialen und räumlichen Ungleichheiten und der Aufwertung benachteiligter Quartiere beschäftigt sind. Dort fungiert Sozialplanung als strukturelles Instrument zur Abmilderung von Armutsfolgen. Die Sozialplanung steht seit jeher in Verbindung zu entsprechenden Politik- und Handlungsfeldern wie beispielsweise dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt und einer gemeinwesenorientierten sozialen Arbeit. Doch nicht nur dort, wo Herausforderungen bereits lange bekannt sind, ist Sozialplanung in der Stadtverwaltung und in der Zusammenarbeit mit Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und weiteren Verbänden angekommen. Der vorbeugende und gestalterische Charakter steht nunmehr genauso im Vordergrund.
2020 verfügten insgesamt 41,1 Prozent aller Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen, einschließlich kreisangehöriger Städte, über eine integrierte Sozialplanung[1] oder führten diese gerade ein (Anton/ Reher 2021, S.3). Bei der Ersterhebung 2013 hieß es, „nur ein Fünftel der Städte, Gemeinden und Kreise in NRW wenden das Instrument der Sozialplanung an (21,8%)“ (Schubert 2014, S.11). Und bis heute machen sich immer mehr kreisangehörige Kommunen und Kreise auf den Weg, Sozialplanung zu implementieren. Mithilfe der letzten Förderung schlossen sich zwischen 2022 und 2024 16 weitere Kommunen der Einführung und Erweiterung ihrer bestehenden Sozialplanung an.
Zur Gegenwart
Inhaltlich betrachten Sozialplanenerinnen und Sozialplaner heute schlichtweg nicht mehr „nur“ soziökonomische Daten. Fach- und rechtskreisübergreifende Prozesse sowie Schnittstellen zu anderen Fachplanungen und Themenfeldern haben an Bedeutung gewonnen. Umweltbezogene Gerechtigkeit und sozial-ökologische Stadtentwicklung, pflegerische Versorgung im Quartier, partizipative Prozessgestaltung durch Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sind einige aktuelle Beispiele. Auch landespolitische Themen, darunter die politische Partizipation von armutsbetroffenen Menschen und Prävention von Wohnungslosigkeit nehmen Einfluss auf die thematische Ausgestaltung der Sozialplanung auf Ebene der Kommunen und Kreise. Sozialplanung ist immer geprägt von aktuellen Entwicklungen und fachlichen Diskursen. Ohne Bezugnahme zum gesamtgesellschaftlichen Kontext kann sie ihre Potentiale nicht ausschöpfen. Sie ist in vielen Kommunen personell und funktional verankert und erfindet sich gleichzeitig immer wieder neu. Dies mag sicherlich auch daran liegen, dass viele Sozialplanerinnen und Sozialplaner aufgrund ihrer Qualifikation und Sozialisation eine gesellschaftliche und wissenschaftliche Neugierde mitbringen. Zusätzlich zu thematischen Weiterentwicklungen gehören auch technisch-methodische Fähigkeiten zum Kosmos der Sozialplanung. Die frei verfügbare Geoinformationsanwendung KomMonitor, mit der sich sozialstatistische Daten sowie Angebote abbilden lassen, ist ein Beispiel dafür, wie neue Instrumente Anwendung finden und sich innerhalb von Nordrhein-Westfalen verbreiten.
Ein Blick in die Zukunft
Finanziell noch engere Spielräume für Sozialausgaben, Digitalisierung und schneller aufeinanderfolgende Krisensituationen durch Umwelteinflüsse werden die Arbeit der Sozialplanung in Kommunalverwaltungen verändern. Sozialplanerinnen und Sozialplaner entwickelten in der ESF-finanzierten Veranstaltung „Netzwerk Sozialplanung NRW“ im Mai 2024 Ideen zum Arbeitsbild in 15 Jahren – etwa: ‚Chatbots beantworten automatisiert Statistikanfragen, die KI gibt innerkommunale Handlungsempfehlungen, die nur noch einer kritischen, integrierten Prüfung bedürfen und nicht zuletzt: es gibt mehr bzw. bessere Daten und Datenbanksysteme, aber der Austausch bleibt dennoch im Persönlichen‘.
Heute schon zeigt sich: Weniger Ressourcen bedeuten auch weniger personelle Kapazitäten und den Ruf nach effizienten und vereinfachten Verfahrenswegen. Digitalisierung bedeutet dabei nicht, Papierformulare in digitale Anwendungsfelder zu übertragen oder Sozialberichte als PDF zu veröffentlichen. Digitalisierung bedeutet, Prozesswege zu automatisieren und letztlich nur mit den Ergebnissen zu arbeiten sowie durch technische Hilfsmittel frei gewordene Kontingente nutzbar zu machen. Ressourcen können dann noch gezielter dafür eingesetzt werden, Lebenslagen mithilfe von Daten in Netzwerken und mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern zu analysieren. Beteiligungsformate können echte Mitgestaltungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger bieten und so zur Demokratisierung beitragen. Begrenzte finanzielle Ressourcen für die Umsetzung von konkreten Angeboten erfordern den zielgerichteten Einsatz von bereits erprobten Konzepten, wie beispielsweise dem „Quartierskümmerer“ mitsamt sozialraumbezogener Anlaufstelle (vgl. Bartling/Czommer 2024).
Der Rückblick mit Blick nach vorn zeigt: Eine integrierte, strategische Sozialplanung verbessert die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, stärkt ganzheitliche Lösungsansätze und übernimmt zentrale Aufgaben wie Projektkoordination und Antragsstellung. Sie ist damit ein wichtiges Instrument für bessere Lebensbedingungen – insbesondere für Kinder, Familien und andere Personengruppen in wirtschaftlichen oder sozialen Schwierigkeiten.
-----
[1] Dabei galten folgende Aspekte: Sozialplanung als Stelle, als Instrument oder als Prozess (vgl. Schubert 2014; Anton/ Reher 2021)
Literatur
Anton, Denise/Reher, Ann-Kristin (2021): Kommunale Sozialplanung in NRW. Ergebnisbericht – Repräsentative Befragung zur Situation der Sozialplanung in Kommunen 2020. G.I.B. Kurzbericht 2/2021. Bottrop. https://gib.nrw.de/publikation/kommunale-sozialplanung-in-nrw-ergebnisbericht-repraesentative-befragung-zur-situation-der-sozialplanung-in-kommunen-2020/ (letzter Abruf: 30.06.2025)
Bartling, Lisa/Czommer, Lars (2024): „Kümmern im Quartier“. Über niederschwellige Vertrauensarbeit und Besonderheiten für Fachkräfte. In: ISA-Jahrbuch zur Sozialen Arbeit 2024. Münster, New York.
Krupop, Stefan (2024): Gezielte Unterstützung der Sozialplanung auf kommunaler Ebene. G.I.B. GmbH (Hg.). G.I.B.-Beiträge zur Arbeits- und Sozialpolitik 2024/24. Bottrop. https://gib.nrw.de/wp-content/uploads/2024/12/GIB-Beitraege_2024-24_Sozialplanung_auf_kommunaler_Ebene.pdf (letzter Abruf:30.06.2025)
Schubert, Herbert (2014): „Sozialplanung als Instrument der Kommunalverwaltung in Nordrhein-Westfalen – eine Strukturanalyse in den Städten und Kreisen“. Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.), Düsseldorf.
Lisa Bartling und Ann-Kristin Reher und Wolfgang Kopal 2025, Zehn Jahre Sozialplanung in NRW - Zwischen Tradition und Innovation, in: sozialpolitikblog, 24.07.2025, https://www.difis.org/blog/zehn-jahre-sozialplanung-in-nrw-zwischen-tradition-und-innovation-173 Zurück zur Übersicht

Lisa Bartling ist Mitarbeiterin der G.I.B. GmbH in der Abteilung Armutsbekämpfung und Sozialplanung. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen die Beratung nordrhein-westfälischer Kommunen zur Ausgestaltung integrierter, strategischer Sozialplanung, die Begleitung landesweiter Förderprogramme, z. B. Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“, „Beteiligung von Armutsbetroffenen, Expertise zur Armutsbekämpfung sowie Sozialplanung in Nordrhein-Westfalen“ und die Verknüpfung von Sozialplanung und Fachplanungen, z. B. Pflegebedarfsplanung, sowie sozialraumorientiere Ausrichtung von (rechtskreisübergreifenden) Maßnahmen.

Ann-Kristin Reher ist Mitarbeiterin der G.I.B. GmbH, Abteilung Armutsbekämpfung und Sozialplanung. Sie ist Sozialwissenschaftlerin M.A. und systemische Supervisorin und Organisationsentwicklerin. Sie war einige Jahre bei InWIS Forschung und Beratung, Bereich Markt- und Standortanalysen für Wohnungsbauprojekte tätig und arbeitet seit 2019 bei der G.I.B. GmbH. Ihre Arbeitsschwerpunkt sind u.a. Beratung nordrhein-westfälischer Kommunen zur Ausgestaltung strategischer Sozialplanung und eines integrierten Wohnungsnotfallhilfesystem; Begleitung landesweiter Förderprogramme, z. B. Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“, Zusammen im Quartier.

Wolfgang Kopal ist Referent im Referat für Armutsbekämpfung, Sozialberichterstattung und Sozialplanung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Abteilung Soziales. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Organisation und Begleitung landesweiter Förderprogramme u.a. zur Sozialplanung und kleinräumiger Quartiersprojekte im Kontext Armutsbekämpfung sowie die Sozialberichterstattung des Landes Nordrhein-Westfalen.