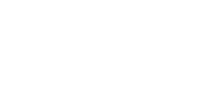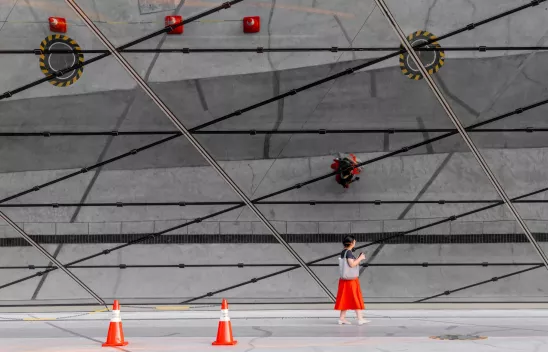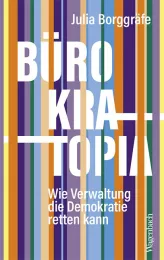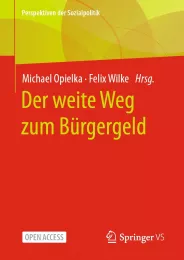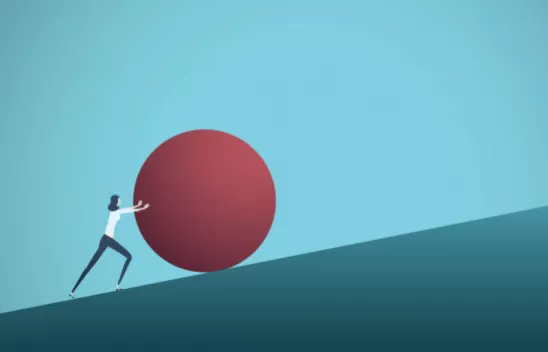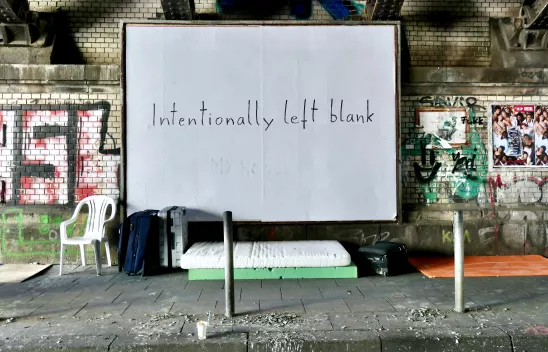Die Karenzzeit für die Kosten der Unterkunft im Bürgergeld
Eine rechtsökonomische Analyse
Im Bürgergeld kann bei der Übernahme der Mietkosten zwischen den tatsächlichen und den angemessenen Kosten der Unterkunft unterschieden werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II). Wie Letztere zu bestimmen sind, ist kompliziert (dazu: Theesfeld-Betten, 2024) und soll nicht der Schwerpunkt des Artikels sein. Dieser Beitrag stellt vielmehr die Dauer, für die die tatsächlichen Kosten der Unterkunft übernommen werden, in den Mittelpunkt.
Seit dem 01.01.2023, der Einführung des Bürgergelds, werden zunächst für ein Jahr die vollen (also die tatsächlichen Kosten) gezahlt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II). Dieses Jahr wird als Karenzzeit bezeichnet. Danach hat der Leistungsempfänger in der Regel ein halbes Jahr Zeit, umzuziehen (§ 22 Abs. 1 Satz 7 SGB II; diese Regelung gab es bereits vor der Einführung des Bürgergelds). Auch in dieser Zeit werden die tatsächlichen Kosten in die Bedarfsberechnung eingestellt.
Die aktuelle schwarz-rote Regierung plant, die Karenzzeit beim Vermögen abzuschaffen (Koalitionsvertrag 2025, Zeile 518). Zu der Karenzzeit bei den Kosten der Unterkunft findet sich folgender Passus: „Dort, wo unverhältnismäßig hohe Kosten für Unterkunft (sic!) vorliegen, entfällt die Karenzzeit.“ Der Blogbeitrag analysiert die Anreizwirkungen der aktuellen Regelungen und erörtert das Potential einer Einschränkung/Abschaffung. Dabei soll auf die Werkzeuge der ökonomischen Analyse des Rechts zurückgegriffen werden, also ein ökonomisch rationales Verhalten des Leistungsempfängers zugrunde gelegt werden (näher dazu: Greiser/Menke, 2022).
Anreize der Karenzregeln
Im Sinne der Solidargemeinschaft sollte ein Bürgergeldempfänger möglichst große Bewerbungsaktivitäten anstrengen, um sich aus der Bedürftigkeit zu befreien (siehe auch: § 2 SGB II). Ein sekundäres Interesse der Solidargemeinschaft liegt darin, dass Bürgergeldempfänger*innen frühestmöglich aus einer unangemessen teuren Wohnung ausziehen. Dies gilt umso mehr, als durch hohe tatsächliche Kosten auch Personen bedürftig im Sinne des SGB II werden, die es bei einer angemessenen Wohnung nicht wären.
Der Gesetzgeber ging bei der Konzeption der Karenzzeit u.a. davon aus, dass Arbeitslose die Zeit, die sie nicht für die Wohnungssuche aufwenden müssen, in Bewerbungsaktivitäten stecken (BT-Drucks. 20/3873, Seite 51). Aus Befragungen von Jobcentermitarbeiter*innen ergeben sich aber kaum Indizien, dass die Betroffenen tatsächlich mehr Zeit in ihre Qualifizierung investieren oder sich stärker auf die Jobsuche konzentrieren (Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung – IAB, 2025). Da Berufstätige neben ihrer Vollzeit-Berufstätigkeit Wohnungswechsel organisieren können, ist die Notwendigkeit einer Befreiung von dieser Aufgabe neben der Arbeitssuche ohnehin zweifelhaft. Insgesamt ist tendenziell keine Erreichung des primären Ziels zu erwarten, sodass das sekundäre Ziel zu priorisieren ist.
Der Bürgergeldempfänger hat häufig wenig Interesse an einem Auszug. Er zieht einen Nutzen aus dem wahrscheinlich höheren Standard der Wohnung oder der besseren Lage und gleichzeitig ist ein Umzug mit persönlichem „Leid“ (in Anlehnung an den in der Agency-Theorie verwendeten Terminus des „Arbeitsleids“) verbunden. Beispielhaft kann der Aufwand der Suche nach einer Wohnung und des Umzugs selbst angeführt werden. „Beharrenskräfte“ und soziale Folgekosten, die sich beispielsweise aus dem Wechsel des Stadtteils ergeben, sprechen aus persönlicher Perspektive ebenfalls gegen einen Umzug. Auch psychologische Aspekte wie das Aufschieben der unangenehmen Aufgabe der Wohnungssuche (Prokrastinieren) sind denkbar (Theesfeld-Betten, 2024).
Müssen die tatsächlichen Kosten nicht selbst getragen werden, werden diese auch nicht in die individuelle Abwägungsentscheidung einbezogen. Der Anreiz, trotz eigentlich zu teurer Wohnung umzuziehen, wird deutlich herabgesetzt. Andere Aspekte wie der Wunsch, anderen nicht zur Last zu fallen, können eine Rolle spielen, sind aber gegenüber einer anonymen Solidargemeinschaft weniger zu erwarten als im familiären Kontext.
Durch die Karenzzeit hat der Mieter auch kein eigenes Interesse, die Miete durch eigenen Aufwand niedrig oder auf dem marktüblichen Niveau zu halten. Im Normalfall, in dem der Bürger bei Beginn des Bezugs bereits in der Wohnung wohnt, wirkt sich das höchstens bei (sonst nicht erfolgten) Mieterhöhungen aus. Es ist allerdings bei erforderlichen Umzügen während der Karenzzeit relevant und empirisch erfassbar (IAB, 2025). Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt legen nahe, dass die Mieten sich an das Niveau der Existenzsicherung anpassen (Deutschen Landkreistag, 2022). Auf Investitionsanreize, die mit höheren erwarteten Mieten einhergehen und „Wettbewerbsvorteile“ von Bürgergeldempfänger*innen gegenüber Wohnungssuchenden mit niedrigem Einkommen (dazu: Deutscher Landkreistag, 2022) kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der aktuell angespannten Lage auf dem Markt für sozialen Wohnraum, die dazu führt, dass es für Leistungsempfänger*innen unstreitig schwierig ist, eine „angemessene“ Wohnung zu finden. Obwohl die Karenzzeit im Einzelfall soziale Härten verhindern kann, handelt es sich originär um ein Problem des sozialen Wohnungsbaus und der Bestimmung der angemessenen Kosten.
Der potentielle Verlust der Wohnung und des damit einhergehenden Lebensstandards kann selbst in die Entscheidung über die Bemühung zur Aufnahme einer Tätigkeit einbezogen werden (zur Arbeitssuche im Allgemeinen: Greiser/Menke, 2022). Durch die Karenzzeit fällt mit der einjährigen Übernahme der tatsächlichen Kosten gleichzeitig ein Anreiz weg, mit der Aufnahme von Arbeit die Wohnung zu halten. Wie stark sich dieser Anreiz auswirkt, ist höchst individuell und deshalb, auch empirisch, nur begrenzt aussagefähig zu quantifizieren.
Folgerungen
Die Überprüfung der Karenzregelungen durch die „neue Regierung“ ist zu begrüßen. Zu definieren, was „unverhältnismäßig hohe Kosten der Unterkunft“ sind, dürfte indes schwerfallen. Die in der Praxis erhobene Forderung, die Karenzzeit abzuschaffen oder wenigstens zu verkürzen (Deutscher Landkreistag, 2022) ist unter der Annahme des Rationalverhaltens begründet. Erstens können Transferzahlungen durch einen frühzeitigen Umzug in eine günstigere/angemessene Wohnung reduziert werden. Zweitens schafft der drohende Verlust der Wohnung Anreize für die Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme. Drittens können drohende negative Folgen auf dem Wohnungsmarkt abgemildert werden.
Literatur
Theesfeld-Betten, C. (2024): Ein Jahr Karenzzeit für die Kosten der Unterkunft im Bürgergeldgesetz – Paradigmenwechsel oder Prokrastination? in: Neue Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 2024, 329 ff.
Greiser, J./Menke, P. (2024): Sanktionen und Sperrzeiten ökonomisch analysiert – Was folgt aus dem Sanktionsmoratorium? in: Zeitschrift für sozialrechtliche Praxis (ZfSH/SGB) 2022, 490 ff.
IAB 2025: Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur „Karenzzeit Wohnen“ zeigen bestenfalls ein gemischtes Bild in: IAB-Forum, 03.04.2025, abrufbar unter: https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
Deutscher Landkreistag, Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Bürgergeld-Gesetz vom 23.08.2022, abrufbar unter: https://www.landkreistag.de/images/stories/themen/Langzeitarbeitslose/220823_Stellungnahme_Buergergeld.pdf
Johannes Greiser und Patricia Menke 2025, Die Karenzzeit für die Kosten der Unterkunft im Bürgergeld, in: sozialpolitikblog, 31.07.2025, https://www.difis.org/blog/die-karenzzeit-fuer-die-kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-172 Zurück zur Übersicht


Patricia Menke ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bilanz-, Steuer- und Prüfungswesen der Universität Osnabrück und seit 2023 zusätzlich als Lehrbeauftragte der Hochschule Osnabrück tätig. Sie studierte von 2015 bis 2020 mit Stipendien der Konrad-Adenauer-Stiftung und anschließend der Studienstiftung des deutschen Volkes Wirtschaftswissenschaften in Osnabrück.