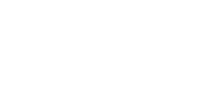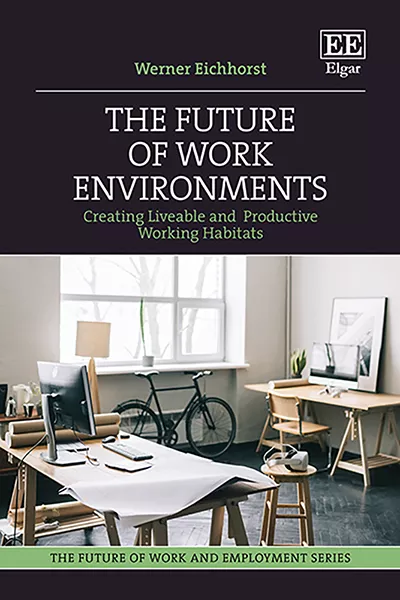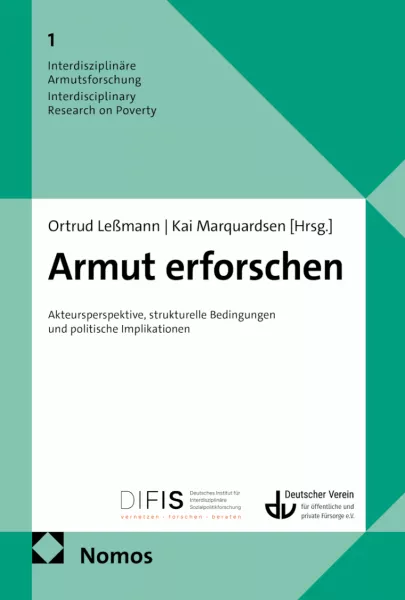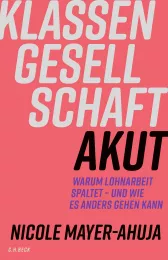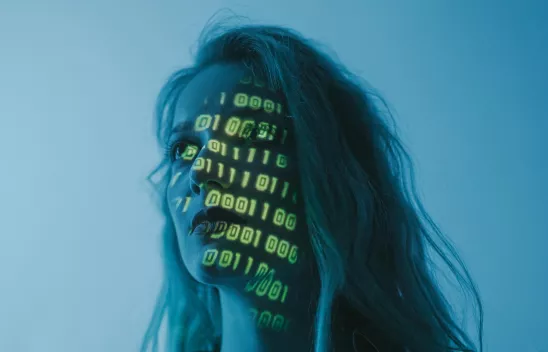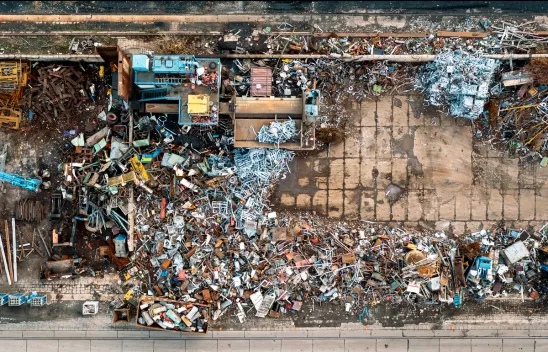Mehr Fordern als Fördern?
Über die Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik in der neuen Legislaturperiode
Interview: Timothy Rinke
Im Mai dieses Jahres hat sich die neue Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD gebildet. Der neue Koalitionsvertrag trägt den Titel „Verantwortung für Deutschland“. Der erste Satz der Präambel lautet: „Deutschland steht vor historischen Herausforderungen.“ Dies gilt in besonderem Maße auch für Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt. Wir möchten uns heute deshalb über Perspektiven für die Arbeitsmarktpolitik in der neuen Legislaturperiode unterhalten. Stichpunkt Strukturwandel des Arbeitsmarktes. Welche aktuellen Entwicklungen sehen Sie dort, insbesondere im Hinblick auf das Beschäftigungswachstum in spezifischen Sektoren?
Es ist ganz entscheidend zu verstehen, dass wir nach einer langen Phase des Beschäftigungswachstums und zuletzt auch immer noch niedriger Arbeitslosigkeit in die neue Legislaturperiode eintreten. Das war eine lange Phase günstiger ökonomischer Rahmenbedingungen bis zum Ukraine-Krieg und den aktuellen globalen Verwerfungen wie den Zollstreitigkeiten mit den USA und der wachsenden Konkurrenz mit China. Man kann rückblickend klar erkennen, dass wir ein starkes Wachstum im Bereich hochqualifizierter, akademisch geprägter Tätigkeiten gesehen haben, ein starkes Wachstum auch im quasi-öffentlichen oder halböffentlichen Bereich. Es gibt zwar immer noch eine im internationalen Vergleich relativ große und stabile Industriebeschäftigung, aber das ist in den letzten Jahren nicht mehr der dynamische Sektor gewesen, auch wenn die Industrie immer noch politisch als zentral angesehen wird.
Der Koalitionsvertrag ist nun im Licht neuer Herausforderungen entstanden.
Der Koalitionsvertrag geht deutlich davon aus, dass wir uns aktuell in einer schwierigeren wirtschaftlichen Lage befinden. Das grenzt sich vom Koalitionsvertrag der Ampel ab. Ob der aktuelle Koalitionsvertrag der Komplexität dieser Herausforderungen wirklich gerecht werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer zu sagen. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt nun auf Wettbewerbsfähigkeit, der Förderung von technologischen Innovationen und Wirtschaftspolitik im weiteren Sinne. Aber auch das Thema Aktivierung tritt jetzt wieder stärker in den Vordergrund. Der Koalitionsvertrag befasst sich weniger mit organisierter Transformation etwa in Bezug auf die Klima-Aspekte. Das ist in den Hintergrund getreten und jetzt nicht mehr so klar erkennbar. Es geht jetzt eher sozusagen um ein „Brot- und Buttergeschäft“ und darum, die Wirtschaft wieder zu dynamisieren. Und darin finden sich die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik unter anderen Rahmenbedingungen wieder als jetzt vielleicht noch vor drei oder vier Jahren.
Aktuell steht die Anhebung des Mindestlohnes als eines der Kernthemen der Arbeitsmarktpolitik im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Welche positiven Effekte oder auch unbeabsichtigte negative Nebenwirkungen sehen Sie?
Zunächst einmal ist es bemerkenswert, dass die Mindestlohnkommission Ende Juni einstimmig zu einer Empfehlung gekommen ist - das war ja durchaus nicht unbedingt zu erwarten. Das Positive ist aus meiner Sicht, dass die Mindestlohnkommission damit ihre eigene Handlungsfähigkeit hat nachweisen können. Es wäre nun ein großer Eklat, wenn politisch noch versucht würde, die 15 Euro durchzusetzen, denn das würde letztlich die Ausschaltung der Mindestlohnkommission bedeuten, die im Koalitionsvertrag auch als unabhängige Instanz gewürdigt wird. Deshalb glaube ich, dass die Entscheidung jetzt insgesamt unter den gegebenen Bedingungen keinen einfachen, aber gerade deshalb akzeptablen Kompromiss darstellt.
Die Mindestlohnkommission hat ja jetzt tatsächlich auch mit Zustimmung der Arbeitgeber eine relativ deutliche Anhebung in zwei Schritten beschlossen. Das kann jetzt unter wirtschaftlich schwierigen Umständen aber durchaus die eine oder andere Branche erheblich unter Druck setzen, beispielsweise das Gastgewerbe oder auch Bereiche des Handels oder privater Dienstleistungen. Im Bereich dieser Dienstleistungen könnte es zu weiteren Preisanhebungen kommen, was natürlich dann teilweise wieder auch zu Lasten der Konsumenten ginge. Man wird genau beobachten müssen, wie sich die Entwicklungen am Arbeitsmarkt in den nächsten ein, zwei Jahren vollziehen und wie dies dann in die Beratung über die nächste Mindestlohnanpassung im Zuge einer Gesamtbewertung einfließen kann. Deutschland bewegt sich von unten her in Richtung des europäischen Ziels von 60 Prozent des Medianlohns. Ich halte es durchaus für vertretbar und logisch, dass das eine gewisse Zeit benötigt und nicht abrupt erfolgen kann.
Sie haben die Betroffenheit von einzelnen Branchen erwähnt, etwa des Gastgewerbes. Diese Teile des privaten Dienstleistungsbereichs könnten besonders von dieser Entscheidung betroffen sein. Wie sieht es für die Beschäftigten aus? Welche Auswirkungen könnte die Entwicklung auf gering qualifizierte Beschäftigte und deren Integrationschancen in den Arbeitsmarkt haben?
Es kann durchaus zu einer gewissen Spaltung des gering qualifizierten oder des Niedriglohn-Arbeitsmarktes kommen. Arbeitgeber haben nun noch stärkere Anreize, in Produktivität zu investieren - sei es durch technische Unterstützung, eine andere Art von Arbeitsorganisation oder in bessere Qualifikationen. Vermutlich wird Personal künftig selektiver ausgewählt, um relativ besser Qualifizierte für den Betrieb zu gewinnen oder zu halten. Einige Beschäftigte könnten dadurch ins Abseits geraten. Damit stehen voraussichtlich einige Arbeitsplätze auf der Kippe. Wenn die Arbeitsproduktivität oder die Arbeitsintensität im Bereich der mindestlohnnahen Beschäftigung gesteigert wird, schränkt das die Aufnahmefähigkeit dieses Segments des Arbeitsmarktes für jedermann oder jede Frau mehr als in der Vergangenheit ein. Das könnte dazu führen, dass wir in den nächsten Jahren eine gewisse Verfestigung von Arbeitslosigkeit oder größere Zugangsbarrieren für bestimmte Gruppen beobachten werden.
Gleichzeitig kann es aber auch zu einem „Upgrading“ derjenigen kommen, die in diesem Bereich in Beschäftigung verbleiben. Auf jeden Fall entstehen dann auch höhere öffentliche Einnahmen, soweit die Beschäftigung stabilisiert wird, denn es gibt dann etwas höhere Steuern und Sozialabgaben der Beschäftigten, die jetzt etwas mehr verdienen. Ob sich das jetzt aber mit Kosten der verlängerten Arbeitslosigkeit von den anderen, die dann eben nicht mehr reinkommen oder die aussortiert werden, neutralisiert, das muss nochmal genau beobachtet werden. Und erst dann, wenn man das abschätzen kann, kann man auch sagen, wie gut machbar der Weg einer weiteren Anhebung von Mindestlöhnen sein wird.
Daneben ist die Reform des Bürgergelds ein zentraler arbeitsmarktpolitischer Aspekt des Koalitionsvertrags. Wie grundlegend ist diese Reform aus Ihrer Sicht?
Ich würde sie als „Korrektur der Korrektur“ bezeichnen. Es gab im Zuge der Corona-Pandemie gewisse temporäre Maßnahmen als Korrektur der wahrgenommenen oder tatsächlichen „Grausamkeiten“ des Hartz-IV-Systems, die dann in das Bürgergeld vermeintlich dauerhaft übernommen wurden. Und der Koalitionsvertrag geht im Grunde jetzt wieder so ein Stück weit dahinter zurück, etwa was die Intensität von Sanktionen angeht, was die Bedürftigkeitsprüfung angeht, was die Angemessenheit der Wohnung angeht, was auch den Anpassungsmechanismus beim Regelsatz angeht. Dabei kommt es zu einer Rückkehr zu einem stärker forderndem und verbindlicheren Aktivierungsregime. Auch der Vermittlungsvorrang tritt nun wieder deutlicher hervor.
Gleichzeitig wird aber auch eine angemessene Ressourcen-Ausstattung der Jobcenter angesprochen. Hier wird es letztlich darauf ankommen, ob und in welcher Form das in die gesetzliche Reform und dann auch in die tatsächliche Praxis der Aktivierung einfließen wird, was ja wiederum auch sehr viel damit zu tun hat, welches Volumen von Ressourcen für unterstützende Dienstleistungen zur Verfügung stehen wird. Bereits jetzt gibt es ganz offensichtlich einen erheblichen Spardruck im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, auch gerade im Bereich Qualifizierung sowie individueller Aktivierungsstrategien oder Unterstützungsstrategien. Wenn im Bereich Bürgergeld Druck entsteht, stärker einzusparen, hat das natürlich Konsequenzen. Entsprechende Einsparungen führen in der Regel dazu, dass gerade bei der aktiven Förderung gekürzt wird.
Und was wir ja aufgrund von Evaluationsstudien und auch der Erfahrung in der Praxis bereits seit längerem wissen, ist, dass man mit einer primär fordernden Arbeitsmarktpolitik bei vulnerableren Gruppen am Arbeitsmarkt keine dauerhafte Integration in Arbeit erreichen kann, allenfalls kurzfristige Abgänge aus der Arbeitslosigkeit, aber keine nachhaltigen Übertritte in stabile Beschäftigungsverhältnisse. Man könnte argumentieren, dass eine stärkere Anhebung des Mindestlohnes und eine stärkere Kompression niedriger Löhne dann besser am Arbeitsmarkt zu machen ist, wenn die beruflichen Qualifikationen der Erwerbspersonen das unterstützen oder ermöglichen. Insofern sollte man beide Aspekte zusammendenken.
Gibt es Herausforderungen, die Ihrer Ansicht nach im Koalitionsvertrag nicht ausreichend thematisiert werden?
Also es gibt auf jeden Fall noch die Schwierigkeit der Fragmentierungen im Sozialstaat zu bearbeiten, also die Abstimmung und das Zusammenwirken verschiedener Politikfelder. Ein gutes Beispiel dafür ist die Komplexität des Weiterbildungssystems in Deutschland, aber mindestens ebenso schwierig ist die Abstimmung von Transfersystemen unter dem Stichwort Arbeitsanreize.
Daneben gibt es mindestens noch zwei weitere Dauerbrenner-Themen, die auch im Koalitionsvertrag partiell angesprochen werden. Zum einen ist das die Vereinheitlichung des Zugangs zur Sozialversicherung, wo es ja in Deutschland verschiedene Ausnahmeregelungen gibt. Das wäre ein Punkt, an dem man arbeiten könnte, gerade im Hinblick auf die Gruppe der Selbstständigen, nicht zuletzt mit Blick auf die Plattformarbeit. Das ist angedeutet und wird, glaube ich, auch in irgendeiner Form sicher adressiert werden. Inwieweit es da zum Durchbruch kommt, ist offen. Zweitens wird meines Erachtens die Erleichterung von Übergängen am Arbeitsmarkt im Koalitionsvertrag wenig betont. Das Thema der Transformation des Beschäftigungssystems angesichts von Klimaschutz, demographischem und technologischem Wandel und deren aktiver Gestaltung war eher das Leitmotiv der Ampelkoalition, spielt aber jetzt in dem aktuellen Koalitionsvertrag zumindest auf der programmatischen Ebene nicht mehr die Rolle, die es jetzt und in Zukunft haben sollte. Man könnte aber durchaus argumentieren, dass die Transformation und diese insgesamt sehr komplexe Umbruchssituation jetzt sogar viel gravierender ist als noch vor ein paar Jahren. Hier bleiben gute Ideen noch Mangelware.
Vielen Dank für das Gespräch!
Werner Eichhorst 2025, Mehr Fordern als Fördern?, in: sozialpolitikblog, 17.07.2025, https://www.difis.org/blog/mehr-fordern-als-foerdern-174 Zurück zur Übersicht

Prof. Dr. Werner Eichhorst ist seit November 2017 Honorarprofessor für europäische und internationale Arbeitsmarktpolitik an der Universität Bremen und mit dem Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik SOCIUM assoziiert. Seit Juli 2005 ist Werner Eichhorst am Institute of Labor Economics (IZA) tätig. Seit Januar 2017 ist er Koordinator für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Europa, seit August 2019 Teamleiter Forschung. Er ist Gründungsmitglied des DIFIS.